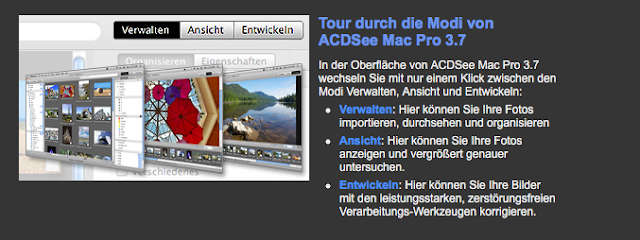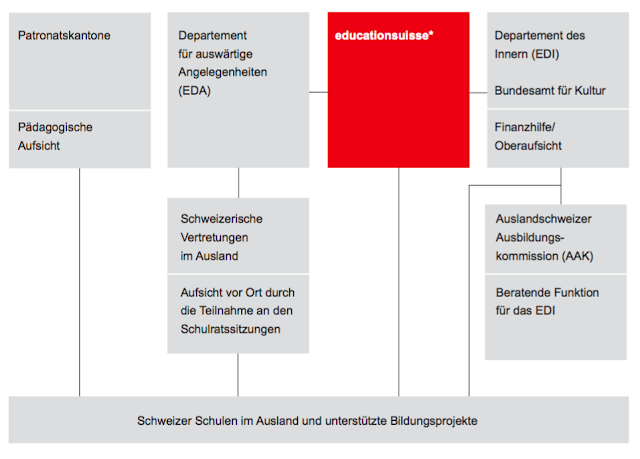Auf der Suche nach der Gottesformel
Ein Videoschnipsel auf Facebook von Prof. Harald Lesch : Er ist Professor für Physik an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Lehrbeauftragter für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie München. Mi 07.10.2009 - 22:15–22:45 ZDF: Auf der Suche nach der Gottesformel (Vgl. sämtliche seiner Sendungen auf Fernsehserien.de) Alle Sendungen bis 2011 von Harald Lesch sind auf ZDF hier ersichtlich . Leider nicht die älteren Sendungen und damit auch nicht besagte Video. Das Video habe ich aus 3 von 4 Videos des Kanals Starkiller112233 zusammengestellt. (Leider fehlt dort die Sendung 3/4) Sendung (ohne den 3. von 4 Teilen) XXX Nur die Gedanken von Harald Lesch in dieser Sendung XXX ZDF schreibt zur Sendung : Auf der Suche nach der Gottesformel Wenn Wissenschaft nach dem Glauben forscht Einst schrieb man unerklärliche Phänomene "höheren Mächten" zu. Der Himmel galt als Hort der Götter. Von dort sandten sie ihre verschlüsselten Botschaften und be