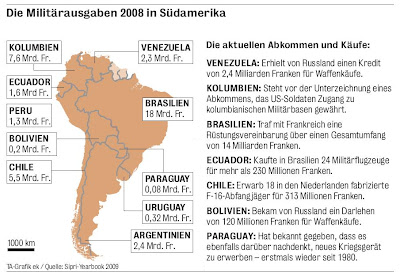346 - Evangelisch reformiertes Gesangbuch 1. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del resucitado: der Friede des Herrn, der Friede - des Herrn, der Friede des Auferstandenen la paz del Señor a ti y a mí, a todos alcanzará. der Friede des Herrn, dich und mich, alle wird er erreichen . 2. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del resucitado: der Friede des Herrn, der Friede - des Herrn, der Friede des Auferstandenen se hace presente ahora y aquí apréstate a recibirla. er erscheint jetzt und hier, mach dich bereit, ihn zu erreichen . 3. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del resucitado: der Friede des Herrn, der Friede - des Herrn, der Friede des Auferstandenen no puede vivir encerrada en sí, apréstate a compartirla. kann nicht in sich verschlossen leben, mach dich bereit, ihn mit anderen zu teilen.